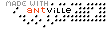Komet Tschuri gibt seine Geheimnisse preis – Physikvortrag von Kometenforscher aus Göttingen
**Marburg. **Es war eine der spannendsten und lustigsten Missionen der letzten Forscherjahre: Wissenschaftler dringen in die Weiten des Weltraums vor, wo noch nie zuvor ein Mensch geschaut hat – und finden eine Quietsche-Ente. So zumindest offenbarte sich der Komet Tschuri den überraschten Astronomen wie Harald Krüger vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung aus Göttingen. Die Badewannen-Ente war nicht nur wissenschaftlich spannend, sondern auch äußerst publikumswirksam. Vor ein paar Tagen stellte Krüger die jüngsten Erkenntnisse vom enten-förmigen Kometen 67P/Churyumov-Gerasimenko, Kosename: Tschuri, einem großen Publikum im Physikgebäude des Renthofs vor.

Kometen bestehen aus zusammengeballtem Staub und gefrorenem Eis. Das macht sie tiefschwarz, weshalb manche Forscher sie auch als dreckige Schneebälle bezeichnen. Sie sind bis zu zehn Kilometer groß. Wenn sie auf ihrer schiefen Bahn in die Nähe der Sonne gelangen, verdampft das Material. Es bildet sich der typische, Millionen Kilometer lange Kometenschweif. Mit der Rosetta-Philae-Mission wollte nun die europäische Raumfahrtagentur ESA mit ihren Partnerorganisationen und Forschern wie Krüger den Kometen mit einer Raumsonde Rosetta besuchen, in eine Umlaufbahn einschwenken und die Tochtersonde Philae auf dem Kometen absetzen. Das Landegerät Philae sollte just in der Phase, in der Komet Tschuri sich am sonnennähsten Punkt um die Sonne bewegt auf der Oberfläche hocken und sich umschauen. Das gelang allerdings nur zum Teil.
Nach zehn Jahren Tour und Schwungholen im Sonnensystem traf die Raumsonde Rosetta im August 2014 bei Tschuri ein. Im Bild der Bordkamera sah der Komet zunächst aus wie eine Erbse, dann etwas näher wie eine Erdnuss, dann offenbarte sich die Entenform. Im Durchmesser ist Tschuri in etwa so groß wie Marburg. Die Auswertung der Daten ergab, dass „Kopf“ und „Rumpf“ ursprünglich zwei getrennte Kometen waren, die kollidierten und dann aneinander kleben blieben, berichtet Krüger. Aus den brillanten Bildern und den Messdaten von einem Dutzend Instrumenten der Raumsonde Rosetta konnten die Forscher die Zusammensetzung und Aktivität des Kometen genauer untersuchen. „Der Komet besteht wohl zur Hälfte aus Wasser“, schätzt Krüger. Die Oberfläche ist zunächst bis zu zehn Zentimeter tief mit Staub bedeckt. Dann kommt eine meterdicke Schicht mit festem Gletschereis, schließlich weiteres poröseres Eis.
Die Zusammensetzung deckt sich zumindest mit der Hypothese, dass unsere Erde in der Zeit der Planetenentstehung ihr Wasser von hereinprasselnden Kometen erhalten hat. Auch können die ersten organischen Moleküle, aus denen sich später Leben entfaltete, von Kometen stammen.

(Bild: Durch die Dunkelheit macht sich Philae auf zu Tschuri.)
Leider haben nicht alle Instrumente der Mission funktioniert. Die Landefähre Philae konnte sich beim Absenken auf die Kometenoberfläche im November 2014 nicht festhaken. Sie hüpfte im langsamen Schwebeflug davon und blieb in einer Felsenspalte hängen. Ohne ausreichend Sonnenlicht auf den Solarzellen ging den Instrumenten nach sechzig Stunden der Saft aus. Vergangene Woche haben die Forscher nach vielen Wiederbelebungsversuchen den Lander aufgegeben. Das Mutterschiff Rosetta umkreist unterdessen weiter um den Kometen. Mit 60.000 Bilder ist der Himmelskörper bis in jede Pore komplett kartiert, berichtet Krüger. Komet Tschuri bewegt sich nun von der Sonne weg. Im September wird Rosetta dann ebenfalls auf dem Kometen aufsetzen und so zur ewigen Ruhe gebracht.
Nächstes Projekt wäre, auf einem Kometen zu landen und Material auf die Erde zurück zu bringen. In den Labors könnten die Proben dann genau untersucht werden, sagt Krüger.
**
Studieren in Mittelhessen**
Studierende können in die Astronomie und Astrophysik an den einschlägigen Fachbereichen der Universitäten wie in Göttingen, Heidelberg oder Bonn einsteigen. In der Luft- und Raumfahrttechnik zählt die Universität Stuttgart zu einer guten Adresse. An der Technischen Hochschule Mittelhessen sowie der Universität Gießen basteln Studierende an Ionenstrahl-Triebwerken für Raumsonden. Da Physik das Grundgerüst für Astronomie und Astrophysik stellt, können Bachelorstudierende auch am Fachbereich Physik der Universität Marburg ins Studium einsteigen. Seit März 2015 ist dort Andreas Schrimpf Professor für Astronomiegeschichte und beobachtende Astronomie.
Marburg. "Wonnebald Pück" -- so einen Namen muss man sich erst mal ausdenken. Doch eine der schönsten und wichtigsten Geschichten von Ricarda Huch trägt den Titel "Lebenslauf des heiligen Wonnebald Pück". Eine furiose Satire auf die katholische Kirche, erklärt Hannelore Schmidt-Enzinger, Lehrerin in Marburg. Der faule, aber bauernschlaue Wonnebald wird von seiner Kaufmannsfamilie, die ihm nichts Bürgerliches zutraut, auf die klerikale Laufbahn geschickt. Und dort wird er immer weiter nach oben befördert -- erst zum Abt eines Klosters, dann zum Bischof --, damit er nicht schlimmeres anrichte. Er braucht nämlich viel Geld und manche List, um sich seinen wonnigen Lebenswandel zu finanzieren. Wäre er nicht nach einem Festmahl an Verdauungsproblemen gestorben, so hätte ihn die Kirche wohl bis zum Herrgott befördert. Immerhin wird er vom Papst heilig gesprochen. Mit Blick auf die Umtriebe des Bischofs in Limburg "eine ziemlich aktuelle Geschichte", sagt Schmidt-Enzinger.
So lohnt es sich, Ricarda Huch wieder zu entdecken.
Die Schriftstellerin und Historikerin Ricarda Huch (1864 bis 1947) zählte schließlich um 1900 zu den bekanntesten Persönlichkeiten in Deutschland. Neben Romanen, Erzählungen, Gedichten (diese laut Marcel Reich-Ranicki allerdings von mäßiger Qualität) schrieb sie auch zahlreiche, teils monumentale historische Werke. Mit zwei Bänden über die Romanik belebte sie die Erinnerung und das Wissen um diese Epoche um 1800 wieder. Interessant ist ihr Verständnis von Tradition, von "Was ist deutsch", sowie dem Reichsgedanken. Das ließ sie kritisch auf Bismarck und das Kaiserreich blicken. Von den Nazis distanzierte sie sich schon früh und trat beispielsweise aus der Preußischen Akademie der Künste 1933 aus. Sie wandte sich allerdings nicht aktiv gegen das Regime, sondern zog sich in eine Art innere Emigration zurück. Später plante sie eine Beschreibung und Würdigung der Widerstandskämpfer gegen die Nazi-Diktatur.
Wieso ist Ricarda Huch also vergessen? Es gibt halt auch andere, neuere Schriftsteller, die nachrücken, meinte einmal der Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki. Zudem ist ihr Schreibstil schwer zu lesen: Lange, gravitätische Sätze (auf halbem Weg zu Thomas Mann, aber weniger ästhetisch elaboriert). Manche Worte sind in ihrer Bedeutung heute ungeläufig; doch daran sieht man, wie sich Sprache und Sprachgebrauch über 100 Jahre ändern. Und die Titel der Geschichten reißen einen nicht vom Hocker, etwa "Der Hahn von Quakenbrück".
Auch in anderen Genres hat sich Ricarda Huch versucht: Mit "Der letzte Sommer" hat sie einen raffinierten Kriminalroman vorgelegt -- empfehlenswert. Ihre Städtebilder sind brillante Miniaturen. "Der Dreißigjährige Krieg" monumental.
Wer Ricarda Huch für sich entdecken will, hat nur wenige Möglichkeiten: Der Buchhandel bietet wenig. Manches ist nur antiquarisch erhältlich -- und dann auch noch in Frakturschrift. Am besten bestückt sind noch die Stadtbüchereien und Uni-Bibliotheken.
Studierende der Konfliktforschung proben und erleben im Rollenspiel, wie sich Konflikte aus unterschiedlicher Sicht anfühlen – Workshop mit Simon Mason von der ETH Zürich.
**Marburg. **Den Menschen gehen die Konflikte nicht aus. Das fängt in der Familie oder WG an und geht bis auf die internationale politische Bühne. Mehr noch: Viele Konflikte werden immer wieder aufs Neue durchfochten oder hören gar nicht mehr auf – siehe der Nahe Osten. Der Konfliktforscher Simon Mason von der Eidgenössisch Technischen Hochschule (ETH) Zürich sieht die internationalen Konflikte in den letzten Jahren gar wieder ansteigen. Rund vierzig Prozent der kriegerischen Auseinandersetzungen lassen sich durch Verhandlungen vermeiden, stellt der Forscher fest. Viele Verhandlungen gehen allerdings schief oder dauerten sehr lange. Es sei daher wichtig, neue Methoden der Verhandlung und Mediation zu entwickeln und zu verbessern.

(Bild: Simon Mason, Jule Bellingröhr, Johannes Becker)
Häufig greifen die Verhandlungsführer dabei auf Planspiele oder Rollenspiele zurück: Die Akteure in Konflikten, auch Diplomaten oder Beobachter (wie Journalisten) wechseln dabei die Rollen und tragen den simulierten Konflikt aus anderer Sicht aus. Für die besonders kniffligen und harten Fälle hat die amerikanische Forscherin Natasha Gill unter dem Namen „Integrierte Simulation“ (englisch: Integrated Simulation) eine viel versprechende, aber anspruchsvolle Methode entwickelt. Dafür erhielt die Forscherin unlängst den Marburger Peter Becker-Preis für Friedens- und Konfliktforschung. Ihr Kollege Simon Mason, bei dem Gill an der ETH die Methode weiter ausgearbeitet hat, stellte das Planspiel mit Studierenden des Zentrums für Konfliktforschung der Phillips-Universität Marburg in einem Workshop auf die Probe.
Der Anspruch des Planspiels von Natasha Gill ist groß: Die Rollenspieler sollen für mindestens zwei Tage, bisweilen aber auch bis zu drei Monate, in die andere Rolle schlüpfen, erklärt die Forscherin. Das soll es den Teilnehmern ermöglichen, nicht nur die Perspektive zu wechseln und den Konflikt rational aus anderer Sichtweise zu betrachten, sondern auch die emotionale Seite wahrzunehmen. Andere – kürzere – Planspiele hätten nach Gill nämlich das Manko, dass die emotionale Ebene zu kurz kommt. Die Forscherin hat ihre Methode über die vergangenen zwanzig Jahre entwickelt und immer wieder erprobt, etwa im Konflikt Palästinenser/Israelis, in Ruanda und Kenia.
Als Mediatorin hat Gill in Kenia 500 Menschen zweier konkurrierender Clans für zwei Tage ins Gespräch gebracht. „Auf der Mikroebene von Vierer- oder Fünfergruppen haben die Leute dann erlebt, was sie blockiert“, sagt Mason. Anspruchsvoll ist hier auch die Vorbereitung: Das Team der Vermittler (Mediatoren), dem auch Vertreter der Konfliktparteien angehören können, bereitet das Planspiel akribisch vor, analysiert die Konfliktlinien und gibt den Rollenspielern zur Vorbereitung dicke Dossiers zum Einlesen in die neue Rolle. Das können schon mal 80 bis 100 Seiten Lesestoff bedeuten. „Ein gutes Design eines Planspiels kann Monate bis zwei Jahre dauern“, erklärt Jule Bellingröhr. Die Sozialwissenschaftlerin leitet als Lehrbeauftragte am Marburger Zentrum für Konfliktforschung die Planspiele.
Die Marburger Studierenden hatten im Workshop zwei Aufgaben, erstens an einem Planspiel zu Frauenrechten im Arabischen Raum teilnehmen, und zweitens ein eigenes Rollenspiel zu einem Konflikt ihrer Wahl entwickeln. Einen halben Tag Planspiel war am Anspruch von Gill gemessen kurz, doch die Studierenden sollten auch nur einen Eindruck von der Methode bekommen und diese auch kritisch hinterfragen. Die 23 Teilnehmerinnen und Teilnehmer schlüpften in die Rollen von Regierungsvertretern, Oppositionspartei, Muslimbrüder und Frauenrechtsorganisationen. Das Ziel ist ein besseres Verständnis der Konfliktdynamik, sagt Workshopleiter Mason. Durch ein Rollenspiel könnten sich die Konfliktparteien beispielsweise auf die eigentlichen Verhandlungen vorbereiten.
Natürlich bildet auch ein Planspiel die Realität nicht korrekt ab, sagt Bellingröhr. Es liegt am Geschick, an der Erfahrung und Vorbereitung durch die Mediatoren, dass ein Rollenspiel gelingt und sich nicht an Stereotypen und Vorurteilen entlang hangelt. „Wichtig für die Studierenden war auch das persönliche Erleben“, sagt Bellingröhr. Wie wurde der Verhandlungsprozess unabhängig vom Ergebnis erlebt? Wie gingen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Frust um? Wie spielt die Persönlichkeit hinein? „In realen Verhandlungen kommt es auch auf die Persönlichkeit der Teilnehmer an“, sagt die Sozialwissenschaftlerin.
Spannend, und aus dem Leben gegriffen, waren auch die Rollenspiele, die die Studierenden selbst entwickelten. Eine Gruppe zerbrach sich den Kopf, wie die Verhandlungen in einer Wohngemeinschaft für einen Putzplan geführt werden könnten. „Rein präventiv, und um Konflikte zu vermeiden“, schmunzelt Bellingröhr. Eine weitere Gruppe überlegte, wie eine Diskussion zwischen Kommunalpolitikern und Bürgern vorbereitet werden könnte, in deren Kommune ein Flüchtlingsheim eingerichtet werden soll. Da wurden auch schnell die Grenzen von ausgedehnten Planspielen deutlich. Zwei Tage nähmen sich Kommunalpolitiker wohl kaum Zeit, um in die Rolle verängstigter Bürger zu schlüpfen. „Mehr als zwei Stunden bekommt man einen Kommunalpolitiker nicht an den Tisch. Das ist alles eine schöne Idee. Doch wer hat so viel Zeit und Geld, das alles vorzubereiten“, kritisiert eine Studentin.
Die eigentliche Lehre ist wohl, dass Planspiele auf die Konflikte angepasst werden müssen. Bellingröhr sieht jedenfalls Planspiele als Chance, die anderen Sichtweisen in Konflikten erlebbar zu machen. „Mit dem Perspektivenwechsel lassen sich durch Empathie die Standpunkte der Anderen verstehen“, sagt die Sozialwissenschaftlerin.
Im Juli können Studierende das mit Bellingröhr wieder ausprobieren. Dann veranstaltet sie ein weiteres Mal ein Rollenspiel zu einem diesmal rein fiktiven Land. Dessen Präsident wähnt die Gesellschaft hinter sich. Doch die Lage eskaliert. Das Militär putscht. Jule Bellingröhr ist dann die Spielleiterin. Die Spieldynamik liegt aber komplett in den Händen der Teilnehmer.
Japanpraktikum führt THM-Studentin ins havarierte Kernkraftwerk
**Gießen.** Ein bisschen mulmig war es Isabella Zahradnik auf der Fahrt durch Fukushima schon. Immer wieder richtete sich ihr Blick auf das Dosimeter, dem Strahlenmessgerät. 4,4 Mikrosievert pro Stunde zeigte die Digitalanzeige. Bei Abfahrt der Forschergruppe im 20 Kilometer entfernten J-Village war die Dosis noch ein Zehntel geringer. „Wir durften unsere eigenen Dosimeter mitbringen“, sagt die 24-jährige Studentin. Damit konnte zumindest sie sich in der Sicherheit wiegen, alles unter Kontrolle zu haben. Mit Mundschutz und Plastiküberziehern ging es im Bus die zerstörten Reaktorblöcke des Kernkraftwerks Fukushima entlang. Ihre Fotos zeigen die zerborstenen Fassaden und die jüngst seitlich errichteten Hilfsstrukturen, um aus dem Innern der Reaktoren die Kernbrennstäbe zu bergen.
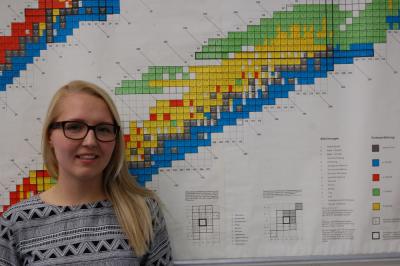
Noch sind die Gefahren nicht gebannt. „Die japanische Behörden sprechen von einem 30 bis 40 Jahresplan“, berichtet Zahradnik, die an der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) für den Master in Strahlenschutz studiert. Für ihr Studium absolvierte sie auch ein Praktikum in einer Außenstelle des TÜV Rheinland, Abteilung Strahlenschutz, in Yokohama. Und da war es für die Nachwuchsforscherin gewissermaßen ein Glücksfall, an jene Stelle zu kommen, die die Einstellung der Menschen zur Atomkraft nochmal grundsätzlich geändert und hier in Deutschland die Energiewende angestoßen hat.
Die Ereignisse vom 11. März des Jahres 2011 kennt Zahradnik wie im Schlaf. Ein Seebeben erschütterte nordwestlich der japanischen Küste um 14.46 Uhr Meeresgrund und Ozean. 50 Minuten später schlug der erste Tsunami mit einer 14 Meter hohen Welle an Land. Die elektrischen Systeme fallen in der Flut aus. Die Kühlung der Brennstäbe funktioniert nicht. Notstromaggregate springen nicht an. Die Brennstäbe brennen durch. Vier von sechs Reaktorblöcken sind zerstört. In dreien ereignet sich die Kernschmelze. Radioaktivität tritt aus. Im Vergleich wurden rund fünf bis zehn Prozent der Radioaktivität wie bei der Tschernobyl-Katastrophe freigesetzt. Die Winde waren indes günstig und wehten von der Küste Richtung Meer. Rund 170.000 Menschen wurden evakuiert.
Die Bewertung ihrer Reise ist für Zahradnik knifflig. Ob die Japaner die Nuklearhavarie im Griff haben, vermag sie nicht zu sagen. Zu kurz und gering waren die Einblicke, die der Betreiber Tepco den Besuchern gewährte. Jedenfalls ist es eine Jahrhundertaufgabe der Ingenieure, die materiellen Schäden bei Fukushima und auch in Tschernobyl zu beseitigen – weitere Langzeitfolgen nicht eingerechnet. Für die europäische Energielandschaft findet es Zahradnik widersinnig, dass Deutschland bis 2020 alle AKWs abschaltet und jenseits der Grenzen Kernkraftwerke weiter laufen. Wissenschaftlich ist das jedenfalls nicht begründet. Doch öffentliche Meinung, das Bild in den Medien und politische Abwägungen unterscheiden sich von Land zu Land. Japan stellt jetzt die ersten AKWs wieder an. Und Zahradnik hatte vermutlich während ihres Interkontinentalflugs nach Japan mehr Strahlung abbekommen als durch die Tagestour in Fukushima. Als gute Nachwuchsforscherin wusste sie das aber schon vorher.
Marburg. Die Lage des Herder-Instituts ist exzellent: Vom Marburger Schlossberg reicht der Blick entlang des Lahntals, an Gießen vorbei bis in die Anhöhen des Taunus. Und exzellent ist auch seine Forschung. Vom Wissenschaftsrat gelobt und europaweit bekannt, widmet sich das Forschungsinstitut der Geschichte Ostmitteleuropas – etwa vom Jahr 1000 bis heute. Die Archive bergen viele Originalquellen, Zeitungen, Zeitschriften, Bildaufnahmen, Landkarten. Bisweilen sind es die letzten Fotoaufnahmen, bevor eine ganze Stadt durch Kriegsgewalt verschwand. Und da diese Kriege mit den Weltkriegen I und II von Deutschland ausgingen, stand die Forschung am Herder-Institut auch immer im Zeichen der Völkerverständigung.
„Dieses Verständnis um die Geschichte und Kulturen der Menschen wird durch die Umbrüche in Osteuropa, von 1989 bis heute, umso wichtiger“, unterstreicht Institutsdirektor Peter Haslinger den praktischen Anwendungscharakter der Arbeit seiner rund 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Durch einen rund 5,2 Millionen Euro teuren Erweiterungsbau, der diesen Dienstag offiziell bezogen wurde, wollen Haslinger und sein Team mit den stürmischen Entwicklungen Schritt halten. Der 6-stöckige Anbau beherbergt im Wesentlichen Archivräume und einen Bürotrakt. Das entspannt die Situation für die Bibliothek und die Quellensammlung, die aus allen Nähten zu platzen drohte.
„Herausragend sind hier die Sammlungen“, sagt die Slavistin Monika Wingender, Direktorin am Gießener Zentrum Östliches Europa. „Das gibt es nicht an der Universität.“ Die Forscher beider Unis in Marburg und Gießen vernetzen sich zunehmend stärker mit dem Herder-Institut, einer unabhängigen Einrichtung, das zum Institutsverbund der Leibnizgemeinschaft zählt. So arbeiten der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der drei Einrichtungen in einem Sonderforschungsbereich zum Thema Sicherheit in Europa, Gewalt und Konflikte zusammen. Haslinger hat in Personalunion auch eine Professur an der Justus-Liebig-Universität (JLU) Gießen. Bald soll sich das Marburger Herder-Institut auch eine räumliche Außenstelle an der JLU einrichten. Durch diese Vernetzung soll insgesamt die Strahlkraft der Osteuropaforschung in Mittelhessen gestärkt werden.
Von Arthur Holl ist nur wenig überliefert. Eine Suchmaschinenabfrage bringt außer ein paar Fachpublikationen nichts Persönliches zutage. Er lebte in der Prä-Internet-Zeit. Jahrgang 1934, gestorben vermutlich um das Jahr 2009 (wie mir Christoph Allgaier von der Universität Tübingen berichtete). Holl war Zoologe, lange Zeit Professor an der Universität Gießen und hatte eine Passion: Spinnen. Ich traf ihn vielleicht zweimal kurz im Jahr 1996, daher ist die Erinnerung etwas blass. Er trat etwas kauzig auf, begeistert und engagiert für die Natur und die dort wuselnden Organismen.
Bis diese Woche vergaß ich ihn ganz. Selbst seinen Namen musste ich nachschlagen. Doch eines blieb mir unvergessen in Erinnerung. Etwas Einmaliges, meines Wissens nie mehr Wiederholtes, Unvorstellbares: Für eine kurze Woche im Juni 1996 präsentierte Holl in einer Ausstellung 100 Spinnenarten, live (!), in Terrarien. Das erscheint eigentlich unvorstellbar: Jede Spinnenart benötigt ihr eigenes ökologisches Umfeld, hat eigene Rhythmen, braucht eigenes Futter, und daher Fütterung in der Ausstellung. Ob diese Zahl daher großzügig aufgerundet war oder nicht: Meine Erinnerung gibt zwei Institutsräume voll gestellt mit Terrarien wieder. (Vielleicht hatten Forscher damals auch mehr Zeit, waren nicht ausgebucht mit dem Anträgeschreiben oder abgelenkt von der Dauer-Internet-E-Mail-Berieselung.)
In der Ausstellung: In einem Moment büxt eine Spinne aus. Tiefschwarz, groß. Mitarbeiterin Sabine Poppe schnappt sie mit hohler Hand. Da 'seilt' sich die Spinne geschwind vom Handteller ab. Schnell. Poppe hinterher. Sie fängt die dahin huschende Spinne erfolgreich ein und setzt sie behutsam ins Terrarium zurück.
Und noch was: Die einzige Spinnenart, die ihr ganzes Leben unter Wasser in einer Luftblase verbringt, Argyroneta aquatica, war dort auch zu sehen.
Diese Woche begegnete mir diese Spinnenart auf überraschende Weise wieder: Forscher um den Zoologen Christoph Allgaier von der Universität Tübingen und den Bauingenieur Jan Knippers von der Universität Stuttgart haben sich nämlich von Argyroneta aquatica abgeschaut, wie sie unter Wasser ihr Netz um die Luft und Leben spendende Blase spinnt. Nach diesem Konstruktionsprinzip hat nun eine studentische Projektgruppe einen Forschungspavillon gebaut: Eine Kunststoffhülle wird pneumatisch aufgeblasen (das entspricht der Luftblase). Drinnen steht ein Industrieroboterarm, der die Folie von innen mit Karbonfasern auskleidet. 45 Kilometer Faser hat der Roboterarm „versponnen“. Entstanden ist eine eindrucksvolle, gesponnene Karbon-Halbschale nach dem Vorbild der Natur und Spinne. Ziel der Entwicklung ist, Leichtbaukonstruktionsweisen der Natur auf technische Objekt zu übertragen.
Die Spinnen der Ausstellung haben Arthur Holl und seine Kolleginnen nach einer kurzen Woche wieder in die Natur entlassen. Er kannte die Fundstellen und Lebensräume genau. Außenstehenden hielt er diese Orte geheim. Begeistert sprach er von jenen sonnigen Plätzen am Kaiserstuhl (nahe Freiburg), wo noch die eine oder andere Spinnenart vorkam. So hoffe ich denn, dass Holl Begeisterung wie auch Wissen an die nächste Forscher- und Laiengeneration weiter geben konnte. Mich hatte die Begegnung jedenfalls in einem verändert: Ich wurde zum Spinnenfreund.
 Eine einfache Statistik zeigt die Vielschichtigkeit, aber auch die Problemzonen der Welt. Die Welt in hundert Köpfen.
Und hier sind die Daten zu einer Infografik verknüpft.
Eine einfache Statistik zeigt die Vielschichtigkeit, aber auch die Problemzonen der Welt. Die Welt in hundert Köpfen.
Und hier sind die Daten zu einer Infografik verknüpft.
.
.
.
.
Last update 02.01.2024