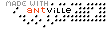**Mit der Kraft einer Schokoladentafel: Mit Ionenantrieben auf große Raumfahrt**
Die Weltraumfahrt – auch in unendliche Weiten – hat mit der irdischen Mobilität eine Gemeinsamkeit: Wenn Raumsonden oder Satelliten einmal in einer Umlaufbahn oder auf dem Weg nach „draußen“ sind, dann düsen sie vermehrt rein elektrisch in der weiten Raum. Zwar müssen die Raketen immer noch mit großem Krawumms vom Boden angelupft werden. Alles Weitere funktioniert besser elektrisch. Das spricht sich in dieser speziellen Mobilitätsbranche nun auch weiter herum. Seit der Flugzeug- und Raumfahrtkonzern Boeing eine Satellitenplattform rein elektrisch vorgestellt hat, ziehen immer weitere Konzerne nach.
Elektrisch Weltraumantriebe, sogenannte Ionentriebwerke, sind eigentlich recht schwach, dafür aber in der Ausdauer immens leistungsfähig. Der Physiker Kristof Holste nimmt gern zum Vergleich eine Tafel Schokolade in die Hand. Ein Viertel dieser 100-Gramm-Tafel – also die Menge weniger Schokostückchen – drückt durch die Schwerkraft genauso stark auf seine Hand wie ein großes Ionentriebwerk auf einen Satelliten ausüben würde. „Klar, mit einem Ionentriebwerk kann man niemals vom Erdboden aus starten“, erklärt Holste, der an der Universität Gießen Ionentriebwerke entwickelt. Doch wenn auch nur eine geringe Strahlkraft permanent und über Tausende Stunden den Satelliten durchs All schiebt, dann kommen hohe Geschwindigkeiten zustande – die nächstgelegenen Planeten wie Mars und Venus oder Merkur im Inneren des Sonnensystems oder die äußeren Planeten kommen so in Reichweite.
Vom Boden abhebend, verbrennen die klassischen chemischen Raketenantriebe große Treibstoffmassen bei Austrittsgeschwindigkeiten von rund vier Kilometern pro Sekunde – für wenige Minuten. Dann ist der Satellit aber auch schon hoch oben. Ein Ionentriebwerk hingegen düst seinen Treibstoff mit bis zu 60 Kilometern pro Sekunde aus, hauchzart, aber bei 50.000 Betriebsstunden.
**Auf den Rückstoß kommt es im All an**
So ein Ionentriebwerk erinnert ein bisschen an einen Fön zum Haaretrocknen. Aus dem Gerät kommt ein warmer Luftstrom raus. Beim Triebwerk sind dies Xenon-Ionen. Xenon ist ein Edelgas und wird in einer Gasflasche mit geführt. Nach dem Verfahren einer Mikrowelle trennen die Konstrukteure die Elektronen in einem Hochfrequenzfeld von einigen Megahertz ab. Das Xenon ist ionisiert, elektrisch positiv geladen und wird per Hochspannung auf ein negativ geladenes Gitter beschleunigt. Das Ganze tritt durch das Gitter und gerichtet aus dem Triebwerk aus. Die Technik fügt zur Neutralisation wieder Elektronen hinzu, und alles düst ins All. Den gleichen Impuls, den die Gesamtmenge des Gases in die eine Richtung erfährt, gewinnt das Raumfahrzeug in die andere Richtung. Das ist klassische Rückstoß-Mechanik à la Sir Isaac Newton aus dem 18. Jahrhundert.
Im 21. Jahrhundert hat mittlerweile mehr als jeder zweite Satellit einen Ionenantrieb an Bord. Auch die aktuell Richtung Merkur fliegende Sonde BepiColombo. Benannt ist das Raumfahrzeug nach dem Italiener Giuseppe „Bepi“ Colombo (1920 bis 1984), der den sogenannten Swing-by mitentwickelte: Raumsonden nutzen bei ihren Touren durch das Sonnensystem das Schwerfeld eines Planeten, um mal so richtig zu beschleunigen und sich in eine andere Richtung zu katapultieren. Bei der aktuellen Mission BepiColombo der europäischen und japanischen Raumfahrtbehörden ESA und Jaxa sind das gleich neun Swing-by Manöver, um an Erde und Venus vorbei zu beschleunigen und an Merkur abzubremsen. Das Finetuning erfolgt dabei durch die Ionentriebwerke. Die Sonde startete im Oktober 2018 und wird im Jahr 2021 am Merkur ankommen. Vergangenen Dezember testeten die Ingenieure der ESA in Darmstadt erstmals die vier Ionentriebwerke an Bord. „Das war eine knifflige Angelegenheit“, berichtete Elsa Montagnon von der BepiColombo-Mission. Bald darauf ging‘s auf Reisegeschwindigkeit, mit einer Kraft von 125 Millinewton, was laut ESA der Gewichtskraft einer Haushaltsbatterie entspricht.
**Energieversorgung über Solarpanels**
„Die Ionentriebwerke werden Standard. Das ist für uns eine spannende Zeit“, sagt Entwickler Holste. An der Universität Gießen wurde mit russischen Kooperationspartnern schon in den 1990er Jahren eine Merkur-Mission erwogen. Damals schlugen die Russen einen Kernreaktor vor, um die Energie für das Ionentriebwerk zu liefern. Die europäische Raumfahrtagentur ESA winkte ab. Später wurden Weltraum-taugliche Solarzellen so leistungsstark, dass heute die Energieversorgung von Satelliten und Raumsonden fast immer über Solarpanels erfolgt.
Aktuell erforschen die Wissenschaftler um Holste etwa zum Antriebsstoff Xenon alternative Materialien. Zum einen ist Xenon recht teuer, zum anderen muss es in 300-bar-Drucktanks mitgeführt werden. Das ist unter den rauen Startbedingungen von Raketen immer ein Sicherheitsrisiko. Ein fester Treibstoff wäre da im Vorteil. Insgesamt muss ein Treibstoff leicht ionisierbar sein und eine hohe Masse haben, damit auch der Rückstoß groß wird. Interessant wäre das Halogen Jod, aber auch so kuriose Stoffe wie Nanodiamanten lagen in einem Kooperationsprojekt mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) aus Göttingen schon auf dem Experimentiertisch.
Wesentlich für die Funktionsweise des Ionentriebwerks ist, dass der Strom positiv geladener Xenon-Ionen beim Austritt aus dem Triebwerk wieder neutralisiert wird. Das geschieht durch Beigabe von Elektronen in den Strom. Würden die positiven Xenon-Ionen allein das Triebwerk und die Raumsonde verlassen, so würde sich die Raumsonde negativ aufladen. Es entstünde ein elektrisches Feld, in dem die Xenon-Ionen auf lang gestreckten Bahnen wieder zum Raumschiff zurück kehrten. Der Vortriebseffekt wäre dann gleich Null.
**Irdische Tests im Weltraum-Tank**
Auch können die Teilchen des Ionenstrahls an Bauteilwände von Triebwerk, Raumsonde oder Solarpanels prasseln und dort zu Erosionserscheinungen führen. In Simulationskammern studieren die Forscher daher das Triebwerk und den Teilchenstrahl unter Weltraumbedingungen. Der Jumbo genannte Tank an der Justus-Liebig-Universität Gießen hat beispielsweise einen Durchmesser von 2,5 Metern und eine Länge von sechs Metern. Über viele Stunden reduzieren die Vakuumpumpen den Innendruck auf unter ein Millionstel Millibar. Statistisch trifft dann ein Luftteilchen erst nach einer Weglänge von einem Kilometer auf ein anderes Luftteilchen. Dort setzen Holste und seine Kollegen die Ionentriebwerke ein und studieren deren Verhalten.
Die Größe und die Leistungsfähigkeit der Ionentriebwerke kann je nach Aufgabe eingestellt werden. Von ihren Abmaßen reichen sie von der Größe einer Kaffeetasse bis zu einem Bierfässchen. Zwei Trends macht Kristof Holste derzeit aus. „Zum einen gibt es die Verkleinerung von Triebwerken für den Einsatz in Kleinsatelliten, zum Beispiel in CubeSats, zum anderen der Bau sehr großer Antriebssysteme für den Flug zum Mars“, erklärt der Physiker. Auf einer Konferenz zu elektrischen Weltraumantrieben und deren Anwendungen haben sich die deutschen Forscher mit ihren russischen Kollegen ausgetauscht. Es ging ganz einfach darum, die Elektrifizierung der Weltraumantriebe weiter voran zu treiben. Wenn es schon am Erdboden mit den Elektroautos nicht so voran geht, wie es wünschenswert wäre. Am Firmament setzen alle auf den Elektroantrieb.
**Die Kraft der Ionen**
Durch den Rückstoß austretender Xenon-Ionen treibt ein Ionentriebwerk die Raumsonde voran. Doch wie stark ist diese Kraft?
Eine Schokoladentafel mit einer Masse von 100 Gramm drückt auf eine Hand mit einer Gewichtskraft von ziemlich genau 1 Newton (der physikalischen Größe für Kraft), was 1000 Millinewton entspricht. Die großen Triebwerke erzeugen Schübe von 200 Millinewton was ungefähr drei Schokostückchen einer klassischen Ritter Sport-Tafel entspricht.
Ein Haarfön übt einen abgeschätzen Schub von 400 Millinewton aus, bei einer Strömgeschwindigkeit von 50 km/h und einem Volumendurchsatz von 90 Kubikmetern Luft pro Stunde. Das entspricht dem Schub von zwei großen Ionentriebwerken.
Der menschliche Atem dürfte laut Physiker Kristof Holste mit Schüben von deutlich einem Millinewton verbunden sein. Diese Kraft erlaubt das Finetuning von Orientierung und Position eines Satelliten im Orbit.
Erinnerung an Lasershow über Marburger Köpfen
**Marburg. **Das waren noch Zeiten. Harald Giessen steigt der Physik aufs Dach, installiert seine Laser und illuminiert für das Stadtfest „3 Tage Marburg“ die Strecke vom Renthof zum Spiegelslustturm zu einem Bürohaus am Lahnufer und wieder zurück an den Schlossberg. Eine Lasershow mit grünem Dreieck, erinnert sich der mittlerweile 50-jährige Starphysiker an seine Postdoc-Zeit in Marburg.

Giessen kommt immer wieder gern nach Marburg. Hier begann seine wissenschaftliche Karriere. Die Kollegen kennen ihn und er kennt sie. Wenn er einen seine eloquenten Vortäge im Renthof hält, streut er seine Ideen nur so aus, und man meint, er nimmt im Diskurs mit Nachwuchsforschern und gestandenen Kollegen auch jede Menge Ideen mit nach Stuttgart. Dort leitet das nach schwäbischer Art wohlwollend bis ironisch genannte Physik-Käpsele ein überaus erfolgreiches physikalisches Institut. (Ein Käpsele ist schlicht eine gescheite, intelligente Person.)
Der Ritus bei den Naturwissenschaftlern ist ja folgendermaßen, und zwar alles andere als das häufige „Redner kommt, schwätzt und geht“. Nein, hier nimmt sich der Gast mindestens einen Tag Zeit, er geht durch fast jedes Labor, schaut, diskutiert, streut Ideen und saugt Interessantes auf. Daraus destillieren die Forscherinnen und Forscher noch am selben Tag, Wochen darauf oder gar Jahre später Forschungskonzepte, die sie in Anträge gießen und dann Geld daraus machen.
Gute Wissenschaft braucht Top-Leute
Der Ex-Marburger Giessen hat es weit gebracht. Über die Uni Bonn nach Stuttgart. Einmal danach gefragt, was er als seine Hauptaufgabe als Physikprofessor sehe, meinte Giessen: Das Heranziehen von Doktoranden. Gute Wissenschaft funktioniert eben nur über Top-Leute. Die Doktoranden schwärmen dann später als Post-Docs an andere Institute aus, werden Professor, kommen in Hightech-Unternehmen unter und verdichten so das persönliche Kooperations- und Wissenschaftsnetzwerk.
Heute zählt Harald Giessen sicherlich zu den besten Forschern in der physikalischen Optik. In jüngster Zeit hat er grundlegende Verfahren mitentwickelt, Minikamera-Objektive zu bauen, die auf die Spitze einer Glasfaser passen und etwa als Endoskop genutzt werden können. Neben dieser extremen Miniaturisierung ist das Spannende daran, dass dieses Objektiv auf das Glasfaserende 3D-gedruckt wird. So könnte man dereinst minimalinvasiv schlicht ein Glasfaserendoskop an der Seite des Auges entlang zur Netzhaut führen, um diese zu inspizieren, meint Giessen. Diese Konzepte diskutierte er beispielsweise mit den Grundlagenforschern um den Marburger Physiker Ulrich Höfer.
Giessen kennt Marburg wie aus der Westentasche und hat in jungen Jahren keine Party ausgelassen. Am Hainweg oder im Landgrafenhaus ließ sich mit den Mädels noch am Besten abtanzen, erinnert er sich. Seine Lasershow dürfte der quirlige Physiker heute aus rechtlichen und Sicherheitsgründen nicht mehr über Marburger Köpfen abhalten. Diese Geräte bleiben im Labor.
**Marburg.** In der ersten Juniwoche trafen sich Physiker und Chemiker an der Uni Marburg. Ihr Tagungsthema: Welche Prozesse laufen da eigentlich an den Grenzflächen verschiedener Materialien ab. Die Ergebnisse sind interessant für moderne Bauelemente: Sensoren, Displays, Mikrochips. Ich sprach mit Tagungsleiter Ulrich Höfer.

**4 Tage Konferenz, 120 Physiker auf einem Fleck. Herr Höfer, was kommt dabei heraus?**
Zunächst interessante Diskussionen. Die Resultate sind da oft verblüffend und nicht vorhersehbar. Kollegen aus Berkeley in Kalifornien und New York interessieren sich für unsere Messtechnik mit dem Laser. Jetzt planen wir gemeinsame Projekte mit der Columbia Universität in New York. Immerhin eine der Top-Unis der USA.
**New York — das verspricht ja interessante Dienstreisen für die Marburger Physiker?**
Die Wissenschaft steht immer im Mittelpunkt (lacht). Eine Forschungsreise sieht ja vielfach so aus, dass man morgens mit dem Flieger ankommt, die Konferenz besucht und am übernächsten Tag wieder abfliegt.
**Also kein Musical am Broadway?**
Das steht noch nicht zur Debatte. Für mich ohnehin lieber die MET.
**Was bringt das Ganze?**
Wir sind für die Weiterentwicklung unseres Sonderforschungsbereichs ein gutes Stück voran gekommen. Die US-Kollegen wollen mitmachen. Das verspricht spannende Physik und beste Chance für die Zukunft.
**Spielt der Ort einer Konferenz eine Rolle?**
Natürlich bieten die historischen Orte wie die Alte Aula und das Schloss in Marburg eine besondere Anregung, um ins Gespräch und auf neue Ideen zu kommen. Unsere Gäste waren jedenfalls begeistert und werden gerne wiederkommen.
Komet Tschuri gibt seine Geheimnisse preis – Physikvortrag von Kometenforscher aus Göttingen
**Marburg. **Es war eine der spannendsten und lustigsten Missionen der letzten Forscherjahre: Wissenschaftler dringen in die Weiten des Weltraums vor, wo noch nie zuvor ein Mensch geschaut hat – und finden eine Quietsche-Ente. So zumindest offenbarte sich der Komet Tschuri den überraschten Astronomen wie Harald Krüger vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung aus Göttingen. Die Badewannen-Ente war nicht nur wissenschaftlich spannend, sondern auch äußerst publikumswirksam. Vor ein paar Tagen stellte Krüger die jüngsten Erkenntnisse vom enten-förmigen Kometen 67P/Churyumov-Gerasimenko, Kosename: Tschuri, einem großen Publikum im Physikgebäude des Renthofs vor.

Kometen bestehen aus zusammengeballtem Staub und gefrorenem Eis. Das macht sie tiefschwarz, weshalb manche Forscher sie auch als dreckige Schneebälle bezeichnen. Sie sind bis zu zehn Kilometer groß. Wenn sie auf ihrer schiefen Bahn in die Nähe der Sonne gelangen, verdampft das Material. Es bildet sich der typische, Millionen Kilometer lange Kometenschweif. Mit der Rosetta-Philae-Mission wollte nun die europäische Raumfahrtagentur ESA mit ihren Partnerorganisationen und Forschern wie Krüger den Kometen mit einer Raumsonde Rosetta besuchen, in eine Umlaufbahn einschwenken und die Tochtersonde Philae auf dem Kometen absetzen. Das Landegerät Philae sollte just in der Phase, in der Komet Tschuri sich am sonnennähsten Punkt um die Sonne bewegt auf der Oberfläche hocken und sich umschauen. Das gelang allerdings nur zum Teil.
Nach zehn Jahren Tour und Schwungholen im Sonnensystem traf die Raumsonde Rosetta im August 2014 bei Tschuri ein. Im Bild der Bordkamera sah der Komet zunächst aus wie eine Erbse, dann etwas näher wie eine Erdnuss, dann offenbarte sich die Entenform. Im Durchmesser ist Tschuri in etwa so groß wie Marburg. Die Auswertung der Daten ergab, dass „Kopf“ und „Rumpf“ ursprünglich zwei getrennte Kometen waren, die kollidierten und dann aneinander kleben blieben, berichtet Krüger. Aus den brillanten Bildern und den Messdaten von einem Dutzend Instrumenten der Raumsonde Rosetta konnten die Forscher die Zusammensetzung und Aktivität des Kometen genauer untersuchen. „Der Komet besteht wohl zur Hälfte aus Wasser“, schätzt Krüger. Die Oberfläche ist zunächst bis zu zehn Zentimeter tief mit Staub bedeckt. Dann kommt eine meterdicke Schicht mit festem Gletschereis, schließlich weiteres poröseres Eis.
Die Zusammensetzung deckt sich zumindest mit der Hypothese, dass unsere Erde in der Zeit der Planetenentstehung ihr Wasser von hereinprasselnden Kometen erhalten hat. Auch können die ersten organischen Moleküle, aus denen sich später Leben entfaltete, von Kometen stammen.

(Bild: Durch die Dunkelheit macht sich Philae auf zu Tschuri.)
Leider haben nicht alle Instrumente der Mission funktioniert. Die Landefähre Philae konnte sich beim Absenken auf die Kometenoberfläche im November 2014 nicht festhaken. Sie hüpfte im langsamen Schwebeflug davon und blieb in einer Felsenspalte hängen. Ohne ausreichend Sonnenlicht auf den Solarzellen ging den Instrumenten nach sechzig Stunden der Saft aus. Vergangene Woche haben die Forscher nach vielen Wiederbelebungsversuchen den Lander aufgegeben. Das Mutterschiff Rosetta umkreist unterdessen weiter um den Kometen. Mit 60.000 Bilder ist der Himmelskörper bis in jede Pore komplett kartiert, berichtet Krüger. Komet Tschuri bewegt sich nun von der Sonne weg. Im September wird Rosetta dann ebenfalls auf dem Kometen aufsetzen und so zur ewigen Ruhe gebracht.
Nächstes Projekt wäre, auf einem Kometen zu landen und Material auf die Erde zurück zu bringen. In den Labors könnten die Proben dann genau untersucht werden, sagt Krüger.
**
Studieren in Mittelhessen**
Studierende können in die Astronomie und Astrophysik an den einschlägigen Fachbereichen der Universitäten wie in Göttingen, Heidelberg oder Bonn einsteigen. In der Luft- und Raumfahrttechnik zählt die Universität Stuttgart zu einer guten Adresse. An der Technischen Hochschule Mittelhessen sowie der Universität Gießen basteln Studierende an Ionenstrahl-Triebwerken für Raumsonden. Da Physik das Grundgerüst für Astronomie und Astrophysik stellt, können Bachelorstudierende auch am Fachbereich Physik der Universität Marburg ins Studium einsteigen. Seit März 2015 ist dort Andreas Schrimpf Professor für Astronomiegeschichte und beobachtende Astronomie.
Japanpraktikum führt THM-Studentin ins havarierte Kernkraftwerk
**Gießen.** Ein bisschen mulmig war es Isabella Zahradnik auf der Fahrt durch Fukushima schon. Immer wieder richtete sich ihr Blick auf das Dosimeter, dem Strahlenmessgerät. 4,4 Mikrosievert pro Stunde zeigte die Digitalanzeige. Bei Abfahrt der Forschergruppe im 20 Kilometer entfernten J-Village war die Dosis noch ein Zehntel geringer. „Wir durften unsere eigenen Dosimeter mitbringen“, sagt die 24-jährige Studentin. Damit konnte zumindest sie sich in der Sicherheit wiegen, alles unter Kontrolle zu haben. Mit Mundschutz und Plastiküberziehern ging es im Bus die zerstörten Reaktorblöcke des Kernkraftwerks Fukushima entlang. Ihre Fotos zeigen die zerborstenen Fassaden und die jüngst seitlich errichteten Hilfsstrukturen, um aus dem Innern der Reaktoren die Kernbrennstäbe zu bergen.
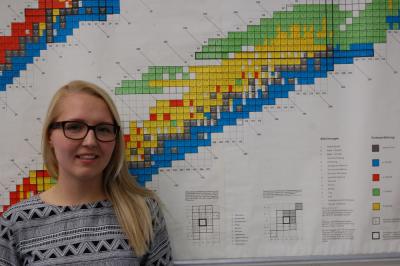
Noch sind die Gefahren nicht gebannt. „Die japanische Behörden sprechen von einem 30 bis 40 Jahresplan“, berichtet Zahradnik, die an der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) für den Master in Strahlenschutz studiert. Für ihr Studium absolvierte sie auch ein Praktikum in einer Außenstelle des TÜV Rheinland, Abteilung Strahlenschutz, in Yokohama. Und da war es für die Nachwuchsforscherin gewissermaßen ein Glücksfall, an jene Stelle zu kommen, die die Einstellung der Menschen zur Atomkraft nochmal grundsätzlich geändert und hier in Deutschland die Energiewende angestoßen hat.
Die Ereignisse vom 11. März des Jahres 2011 kennt Zahradnik wie im Schlaf. Ein Seebeben erschütterte nordwestlich der japanischen Küste um 14.46 Uhr Meeresgrund und Ozean. 50 Minuten später schlug der erste Tsunami mit einer 14 Meter hohen Welle an Land. Die elektrischen Systeme fallen in der Flut aus. Die Kühlung der Brennstäbe funktioniert nicht. Notstromaggregate springen nicht an. Die Brennstäbe brennen durch. Vier von sechs Reaktorblöcken sind zerstört. In dreien ereignet sich die Kernschmelze. Radioaktivität tritt aus. Im Vergleich wurden rund fünf bis zehn Prozent der Radioaktivität wie bei der Tschernobyl-Katastrophe freigesetzt. Die Winde waren indes günstig und wehten von der Küste Richtung Meer. Rund 170.000 Menschen wurden evakuiert.
Die Bewertung ihrer Reise ist für Zahradnik knifflig. Ob die Japaner die Nuklearhavarie im Griff haben, vermag sie nicht zu sagen. Zu kurz und gering waren die Einblicke, die der Betreiber Tepco den Besuchern gewährte. Jedenfalls ist es eine Jahrhundertaufgabe der Ingenieure, die materiellen Schäden bei Fukushima und auch in Tschernobyl zu beseitigen – weitere Langzeitfolgen nicht eingerechnet. Für die europäische Energielandschaft findet es Zahradnik widersinnig, dass Deutschland bis 2020 alle AKWs abschaltet und jenseits der Grenzen Kernkraftwerke weiter laufen. Wissenschaftlich ist das jedenfalls nicht begründet. Doch öffentliche Meinung, das Bild in den Medien und politische Abwägungen unterscheiden sich von Land zu Land. Japan stellt jetzt die ersten AKWs wieder an. Und Zahradnik hatte vermutlich während ihres Interkontinentalflugs nach Japan mehr Strahlung abbekommen als durch die Tagestour in Fukushima. Als gute Nachwuchsforscherin wusste sie das aber schon vorher.
Die Quantenrechner kommen. Jedenfalls "haben wir vielleicht schneller so einen Quantencomputer als wir denken", sagte kürzlich Jörg Wrachtrup von der Uni Stuttgart. Dort hat sein Team mit großzügigem experimentellem Setup einen Mini-Quantencomputer mit drei Qubits (realisiert durch drei Kernspins der Atome Stickstoff und zweimal Kohlenstoff C-13) im Diamantgitter zum Laufen gebracht.
Das Problem ist ja, dass die verkoppelten-verschränkten Quantenzustände der Qubits mit der Zeit wegdriften -- Quantenrechner machen Fehler. Hauptgrund sind die Umgebung und die Temperatur, die stören. Daher braucht es eine effiziente Fehlerkorrektur, also spezielle Rechenvorschriften im Gesamtsystem, um diese Drift zu kompensieren. Genau das ist Wrachtrups Doktorand Gerald Waldherr (29) gelungen. Hier auch der Link auf die zugehörige Publikation im Fachmagazin Nature und mein Stück in der Stuttgarter Zeitung.
Waldherrs Kollege Ya Wang hat mir auch eine nette Fortbildung in Sachen Quanteninformationsverarbeitung gegeben. Am Tableau rechnete er vor, dass man zum Knacken aktueller Internetverschlüsselung (RSA-Schlüssel mit 1024 Bits) rund 4.000 Qubits bräuchte. Ob es jemals einen solchen Quantencomputer gibt, ist völlig offen.
Bei der Verifizierung des Higgs-Teilchens müssen die Physiker jetzt die Statistik bemühen. Da gibt es zwei Ziellinien, ab 99,73% Wahrscheinlichkeit (3-Sigma) sprechen die Wissenschaftler von einem Anzeichen für ein neues Teilchen, ab 99,99994% (5-Sigma) von einer Entdeckung.
Das 5-Sigma-Ziel haben die Forscher vergangenen Sommer (Verkündung 4.7.2012) erreicht. "Wir sind sicher, ein neues Teilchen gefunden zu haben", sagte mir Karl Jakobs, Physiker an der Uni Freiburg und Sprecher der deutschen Forscher an einem der beiden Higgs-Nachweisdetektoren, dem Experiment Atlas.
Um das neue Teilchen als Higgs-Teilchen auch zweifelsfrei fest zu machen, dazu müssen die Forscher das 5-Sigma-Ziel bei den Higgs-Eigenschaften noch erreichen. Dazu zählt der Spin. Er sollte bei Null liegen. Das Higgs ist das Austauschteilchen eines sogenannten skalaren Feldes (also ohne vektorielle Vorzugsrichtung wie etwa bei einem elektromagnetischen Feld) mit Spin Null. Bei diesen Eigenschaften liegen die Forscher zwischen 2- und 5-Sigma.
Die jüngste Konferenz in La Thuille, Anfang März, zeigte, dass die Forscher auf gutem Wege zum Higgs sind. Vielleicht sogar 'zu gut', denn das Teilchen scheint sich nur zu gut in das Standard-Modell einzufügen. Dabei hätten einige Forscher auch ganz gern auf überraschende Abweichungen von den Modellen gesetzt, um auf eine neue Physik schließen zu können: weitere Raumdimensionen, Dunkle Materie.
Aber vielleicht wird's noch was. Auf der nächsten Sommerkonferenz in Stockholm wissen wir mehr, meint Jakobs.
Last update 02.01.2024